Schutz von Software und digitalen Leistungen – Neue Wege für Entwickler jenseits des Urheberrechts Viele…
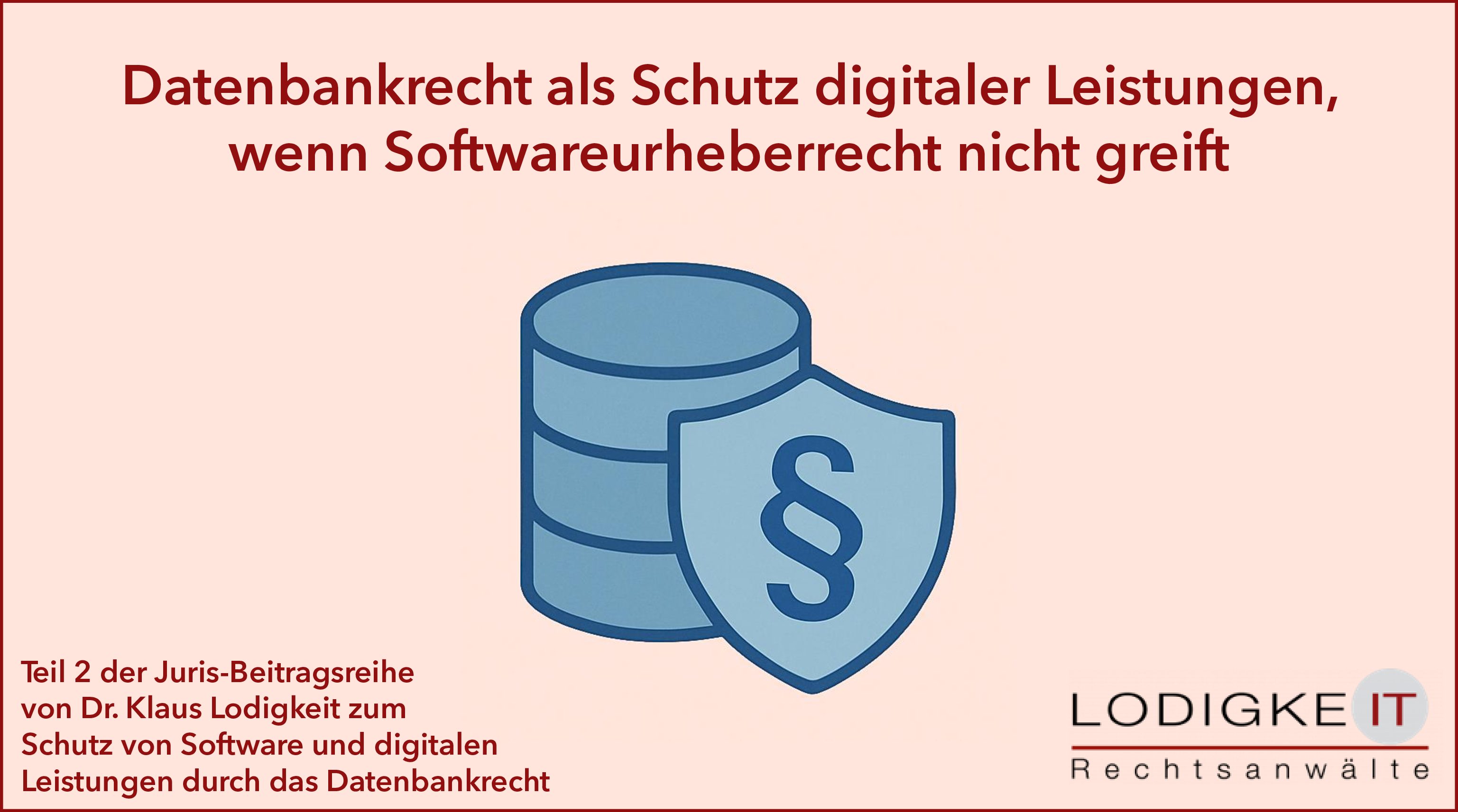
Warum das Datenbankrecht oft der entscheidende Rettungsanker ist
Die Digitalisierung hat unzählige neue Geschäftsmodelle hervorgebracht, von komplexen Finanzanalyse-Tools bis hin zu simplen webbasierten Templates. Doch was viele nicht wissen: Nicht jede digitale Leistung ist automatisch urheberrechtlich geschützt. Gerade solchen Softwarelösungen, die auf Standardkomponenten, gängigen Listenfunktionen oder routinemäßigen Programmierleistungen beruhen, fehlt es oft an der nötigen Schöpfungshöhe.
Jüngst hat auch der Bundesgerichtshof die engen Schutzgrenzen des Softwareurheberrechts betont: In der Entscheidung „Action Replay II“ (Urteil vom 31.07.2025 – I ZR 157/21) stellte er klar, dass Programme, die lediglich laufzeitbezogene Speicherzustände verändern, wie etwa Cheat-Software für Computerspiele, keine Verletzung des urheberrechtlich geschützten Codes darstellen.
Dass in solchen Fällen das Datenbankrecht einspringen kann, zeigt ein Urteil des EuGH (C‑762/19, CV‑Online Latvia): Es schützt investitionsintensive Datensammlungen auch dann, wenn der Schutz durch das Softwareurheberrecht versagt.
Datenbank als ergänzender Schutzmechanismus bei Software ohne Urheberrechtsschutz
Hier setzt der zweite Teil der Beitragsreihe von Rechtsanwalt Dr. Lodigkeit an. Unter dem Titel „Der Schutz von Software und digitalen Leistungen durch das Datenbankrecht (Teil 2)“ erläutert er, warum das Datenbankrecht gerade in Fällen fehlender Originalität eine entscheidende rechtliche Absicherung bieten kann. Der Beitrag führt zunächst in die Grundzüge des deutschen und europäischen Datenbankrechts ein und erklärt, weshalb der Schutz einer Datenbank nicht nur deren Inhalt, sondern insbesondere auch ihre Struktur, Organisation und die damit verbundenen Investitionen umfasst.
Softwareurheberrecht vs. Datenbankrecht: Keine bloße Notlösung
Besonders praxisrelevant ist dabei die Unterscheidung zwischen Softwareurheberrecht und Datenbankrecht. Dr. Lodigkeit zeigt auf, dass das Datenbankrecht kein bloßes Minus des Softwareurheberrechts ist, sondern vielmehr einen eigenständigen Schutzmechanismus bietet, der gerade dann greift, wenn einfache Programmierungen oder digitale Strukturen keine ausreichende Individualität für einen urheberrechtlichen Schutz aufweisen.
So können etwa geordnete Finanzdaten, Listenstrukturen oder Protokolldaten einer Software durchaus als Datenbank geschützt sein, obwohl die Software selbst keinen originären Schutz beanspruchen kann.
Praxisbeispiel aus unserer Kanzlei: In einem von uns geführten Verfahren zu einem SharePoint-basierten Partnerportal hat das Gericht Ansprüche aus dem Softwareurheberrecht (§§ 69a ff. UrhG) mangels hinreichend dargelegter Programmschutzfähigkeit zurückgewiesen und die Nutzung zudem von einem Vergleich gedeckt gesehen. Datenbankrechte waren dort nicht streitgegenständlich. Genau das zeigt, wie wichtig es ist, in datengetriebenen Plattformen frühzeitig den Datenbankschutz mitzudenken und strategisch geltend zu machen, wenn die Softwarekomponente urheberrechtlich nicht trägt.
Voraussetzungen für Datenbankschutz: Struktur, Systematik und Investition
Der Beitrag beleuchtet ferner, welche Voraussetzungen für den urheberrechtlichen Schutz als Datenbankwerk erfüllt sein müssen, etwa die systematische oder methodische Anordnung unabhängiger Elemente, und warum bloße Zusammenstellungen ohne konzeptionelles Arbeiten keinen Schutz genießen.
Besonders interessant ist hierbei die Darstellung des sogenannten „Sui-generis-Schutzes“ nach der EU-Datenbankrichtlinie und § 87a UrhG: Dieser schützt nicht kreative Leistungen, sondern die Investition in Beschaffung, Überprüfung und Darstellung der Daten mit der Konsequenz, dass selbst Telefonverzeichnisse oder umfangreiche Linksammlungen unter bestimmten Voraussetzungen Datenbankrechtsschutz genießen können.
Rechte des Datenbankherstellers und aktuelle Entwicklungen
Darüber hinaus erläutert Dr. Lodigkeit, wer im rechtlichen Sinne als Datenbankhersteller gilt, welche Rechte dieser innehat und welche Abgrenzungsfragen sich im Verhältnis zum Urheberrecht stellen. Auch auf die aktuelle Rechtsprechung des BGH und die Auswirkungen der europäischen Data Act-Regelung wird eingegangen.
Abschließend behandelt der Beitrag die für die Praxis so bedeutsame Frage der Beweislastverteilung in Prozessen um Software- und Datenbankrechtsschutz.
Fazit: Datenbankrecht im digitalen Geschäftsmodell strategisch nutzen
Der Beitrag ist lesenswert für alle, die digitale Geschäftsmodelle entwickeln, Software erstellen oder Datenbanken aufbauen und betreiben. Denn nur wer die Abgrenzung zwischen Softwareurheberrecht und Datenbankrecht versteht, kann seine Produkte wirksam schützen und Haftungsrisiken minimieren.
Lesen Sie jetzt den vollständigen Beitrag von Rechtsanwalt Dr. Lodigkeit und erfahren Sie, warum das Datenbankrecht gerade im digitalen Zeitalter häufig den notwendigen rechtlichen Rückhalt bietet, wenn Softwareurheberrecht nicht greift und wie Sie diesen Schutz strategisch für Ihr Unternehmen nutzen können.
Der Beitrag ist erschienen in: Lodigkeit, AnwZert ITR 172024 Anm. 2.
Verwandte Beiträge
- Das EU-Datenbankrecht (Teil 1)
- Digital Markets Act (Teil 2)
Wie die EU den Wettbewerb im Rahmen digitaler Märkte sichern will Welche praktischen Folgen hat…
- Digital Markets Act (Teil 1)
Neue Regularien für faire digitale Märkte in Europa Digitale Plattformen sind längst ein fester Bestandteil…



